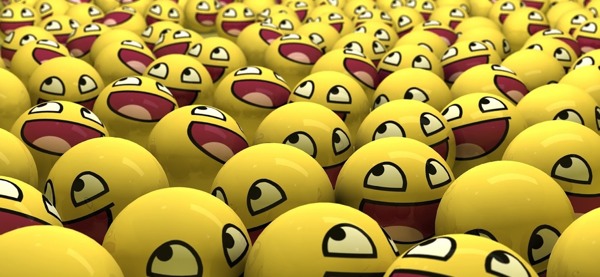Wer nicht genießt, ist ungenießbar.
Meine letzte Arbeitswoche gestaltete sich so: am Montag Morgen flog ich nach Berlin, am Abend zurück nach Wien, Dienstag Mittag hob ich ab nach Köln/Bonn, Mittwoch um 5 Uhr morgens zurück auf den Flughafen, 8 Uhr Landung in Wien, 4 Stunden warten, Telefonate führen, Mails beantworten, 13 Uhr Weiterflug nach Innsbruck, mit dem Taxi zum Bahnhof, 2 Stunden Zugfahrt nach Bozen, Donnerstag früher Nachmittag wieder mit dem Zug nach Innsbruck, vom Bahnhof zum Flughafen, von dort mit dem Flieger nach Wien, am Abend Flug nach Graz, Samstag ab in die Kärntner Wahlheimat. Ich bin wirklich in keiner schlechten körperlichen Verfassung, aber so eine Woche ist nicht ohne, da es ja auch darum geht, zwischen all den geschäftlichen Reisen zu schauen, dass Projekte sich weiterentwickeln, der Alltag organisiert wird, unzählige Termine wahrgenommen werden. Die Frage nach dem Warum stellt man sich erst mit zunehmendem Alter. Nicht was die Arbeitsbelastung anbelangt, sondern eher wegen vieler Menschen, die dir im Laufe eines Berufslebens begegnen und die oftmals den Alltag nur damit verbringen, irgendwo eigenes Unvermögen damit zu kompensieren, indem man sogenannten Dienstleistern eine unerreichbare Karotte vor die Nase hängt, um als Vorleistung für Aufträge, die nie kommen werden, kostenlos Ideen und Know-how zu generieren. Willkommen in der Dienstleistungsgesellschaft! Ich schreibe all das nicht, um mich selbst zu bemitleiden, nach Phasen der Talfahrt geht es irgendwann auch wieder nach oben, das ist nach vielen Jahren der Selbstständigkeit eine gesicherte Erkenntnis. Oftmals schreibe ich solche Gedanken schon deshalb nieder, um einen Anker für die persönliche Reflexion des Geschehenen zu haben.
Gestern Nacht wurde ich aus dem Schlaf gerissen, weil mich zu viele Dinge beschäftigen. Kurz nach 3 Uhr war ich putzmunter, nachdem ich erst kurz zuvor zu Bett gegangen war. Ich setzte mich ins Wohnzimmer, um eine wesentliche Entscheidung zu treffen: sollte ich noch ein Glas Rotwein trinken, um die Schlafpause zu verkürzen, oder doch eine frische Ingwer Wurzel aufkochen? Für die letztere Variante habe ich mich entschieden. Bei heißem Tee habe ich ein paar Zeitungen gelesen. Ich stieß dabei auf eine Story, die die Geschichte des Schülers Jiang Chengbo erzählt. Wie in China üblich, gibt es auf Eliteschulen zu Wochenbeginn Fahnenappelle, bei denen sich im Normalfall einige tausend junger Menschen versammeln und ein auserwählter “Musterschüler” eine Rede vortragen darf, die ihm vom Lehrpersonal vorgeschrieben wird. Der 17jährige Paradeschüler hat darauf hin etwas gemacht, dessen Dimension man erst dann begreift, wenn man berücksichtigt, dass der Ort des Geschehens ein autoritärer Staat unter der Führung der Kommunistischen Partei Chinas ist, dessen Führungsstrukturen im Normalfall durch wenig Humor im Alltag auffallen. Jiang Chengbo beginnt die *Rede wie im Manuskript vorgeschrieben: “Verehrte Lehrer und Mitschüler! Heute heißt mein Thema: Mache aus Dir den Besten. Zuerst möchte ich einige Statistiken anführen: Bei Untersuchungen, die 2009 in 21 Ländern durchgeführt wurden, kamen chinesische Schüler in Mathematik auf Platz Eins.” Um dann von den inhaltlichen Vorgaben abweichend seine eigene Botschaft den anwesenden Schülern zu übermitteln, bevor er noch einige grundsätzliche Anmerkungen zu einem Bildungssystem hatte, in dem der 14 Stunden Unterricht zum Alltag gehört und Menschen wie Maschinen herangezüchtet werden, die mit leistungssteigernden Infusionen zu Prüfungen erscheinen, um all den Anforderungen eines fehlgeleiteten Systems gerecht zu werden. Schlussfolgernd sagt er in seinen Ausführungen, im Schulhof der über 5 Millionen Einwohner zählenden Metropole Nanjing: “Wir sind Menschen und keine Maschinen.” Um dann seine Forderungen zu präzisieren: “Mitschüler! Hört nicht mehr monotonen Predigten zu, hört auf, immer mithalten zu wollen, eure Schwächen aufzuholen! Haltet Euch nicht mit solchem Kinderkram auf, vergeudet nicht euer Leben! Die Ziele und Ideale unserer Zeit sind falsch und krank. Strebt nach einem wundervollen Leben, in dem ihr die Besten seid.” Dieser Auftritt hat ein mediales Beben in ganz China ausgelöst, die Repressionsmaschine ist angelaufen, der Schüler wurde anfangs von der Schule verwiesen. Mittlerweile darf er wieder zum Unterricht, zu viele Diskussionen hatten seine Formulierungen ausgelöst.
Wie ein chinesischer Eliteschüler fühle ich mich nicht, aber manchmal denke ich mir schon, wo das Leben bleibt. Wenngleich ich mir eigentlich sicher bin, dass ich für mich ein gutes Regelwerk zwischen Beschleunigung und Entschleunigung im Alltag gefunden habe. Nach Phasen der intensiven Arbeit verstehe ich es auch, mich zurückzunehmen und mein einziges Leben, das ich vermutlich habe, zu genießen. In meiner Beobachtung von anderen mich umgebenden Zeitgenossen frage ich mich dennoch manchmal, wofür sie überhaupt leben? Oder anders formuliert, was macht bei ihnen der Unterschied zwischen tot und lebendig überhaupt aus? Der Philosoph Robert Pfaller fragt sich in seinem 2011 veröffentlichten Buch “Wofür es sich zu leben lohnt” zu Recht, warum sich u nsere Kultur immer mehr dem Genuss versperrt? *“Er wird nicht müde, vor der Maßlosigkeit der Mäßigung zu warnen, die unsere Gesellschaft befallen hat – mit Kneipen ohne Rauch, Sahne ohne Fett, Bier ohne Alkohol, virtuellem Sex ohne Körperkontakt. Sein Fazit: Nur ein Leben in einer funktionierenden Gesellschaft, welche den Individuen die Ressourcen des Genießens bereitstellt, anstatt ihnen bequemerweise alles Anstößige zu verbieten, ist ein Leben, für das es sich zu leben lohnt.” Pfallers Kollege, der französische Philosoph Michel de Montaigne (1533–1592) bemerkte schon zu seiner Zeit „Wir dürfen niemals vergessen: Unsere vornehmste Aufgabe ist es, zu leben.“ Eine unlängst vom Institut Rheingold Salon veröffentliche Studie „Die Unfähigkeit zu genießen” gibt da wenig Hoffnung, ob die Botschaft beim Volk schon angekommen ist. Wir sind am besten Weg, das Genießen zu verlernen, so die ernüchternde Schlussfolgerung. Der 1375 verstorbene Schriftsteller Giovanni Boccaccio formulierte eine ganz einfache Formel, um den Genussfaktor zu überprüfen, wie ich meine: “Es ist besser, zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.” Dem gibt es aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen. Ich wünsche den Lesern meiner kleinen Kolumne einen genussvollen Wochenbeginn!
* http://www.welt.de/politik/ausland/article106381214 * http://www.welt.de/debatte/kommentare